Hörsturz / Tinnitus
Gerne bieten wir einen kostenlosen Hörtest an um Ihre persönliches Hörsituation zu ermitteln.
Symptome
Charakteristisch und definierend ist ein plötzliches, meist einseitiges Auftreten des Hörverlustes. Auslösende oder verursachende Faktoren lassen sich nicht feststellen. Ein einseitiges Druckgefühl und ein Ohrgeräusch (Tinnitus) (meist hochfrequent) im betroffenen Ohr können erste Vorboten sein. Der Hörsturz ist niemals von Ohrenschmerzen begleitet. Bei einer einseitigen, plötzlichen Hörminderung mit Ohrenschmerzen muss daher eine andere Erkrankung angenommen werden.
Parallel zur Hörstörung können andere Symptome auftreten:
- Ohrgeräusche (Tinnitus) – 80%
- Druckgefühl im Ohr
- Haut „wie betäubt“ oder „wie Watte“/wattig – durch die plötzlich fehlende akustische Rückkoppelung bei Berührung der Ohrmuschel, echte Hypästhesie nicht nachweisbar – 50%
- Schwindelgefühl (Vertigo) – 30%
- Doppeltonhören (Diplakusis) – ein Ton wird auf dem einen Ohr normal, auf dem anderen (erkrankten) Ohr höher oder tiefer gehört – 15%
Schwerhörigkeit
Unter Schwerhörigkeit versteht man eine Minderung des Hörvermögens. Die Ausprägung der Störung kann von einer leichten Schwerhörigkeit bis zur Gehörlosigkeit reichen und vielfältige Ursachen haben. Nach einer Untersuchung haben in Deutschland etwa 19% der Gesamtbevölkerung über 14 Jahren keine völlig normale Hörschwelle mehr. Deutlich geringer ist jedoch jener Prozentsatz der Bevölkerung, der eine so fortgeschrittene Schwerhörigkeit hat, dass dadurch eine Behinderung im Alltagsleben besteht. Naturgemäß steigt der Anteil Schwerhöriger mit zunehmendem Alter.
Gerne bieten wir einen kostenlosen Hörtest an, um Ihre persönliche Hörsituation zu ermitteln.
Ursachen
Bei einem derart komplexen Organ, wie dem Ohr, können sich an vielen Stellen Störungen einschleichen. Dabei liegt in den wenigsten Fällen ein Defekt bereits von Geburt an vor. Neben genetischen Vorbelastungen können hier Krankheiten (z.B. Röteln), Alkohol- oder Drogenkonsum der Mutter eine Rolle spielen.
Im Laufe des Lebens sind es dann häufig lang anhaltende oder sogar lebenslange schädliche Einwirkungen, die das Gehör irreparabel schädigen können. So z.B. ototoxische Medikamente, falsche Ernährung, Stress oder Nikotinkonsum. Solche Einflüsse können im Durchschnitt ab dem 55. Lebensjahr zu einer Hörminderung führen.
Ein brisantes Thema in diesem Zusammenhang ist Lärm. Unsere Umwelt wird immer lauter. (Lärmometer) Sei es durch Verkehrsbelästigung, Baustellenlärm, allgegenwärtige Musikberieselung oder die durchgehende Geräuschkulisse am Arbeitsplatz. Gerade die junge Generation der Disco- und Konzertbesucher setzt sich zudem regelmäßig immensen Lautstärken aus. Hörschäden werden quasi vorprogrammiert. Effektiver Gehörschutz stellt in diesen Situation eine sehr gute Maßnahme dar, um auch noch im Alter Spaß am Musikerlebnis zu haben.
Anatomie des Ohres
Beim Menschen wird das Ohr in drei Bereiche eingeteilt.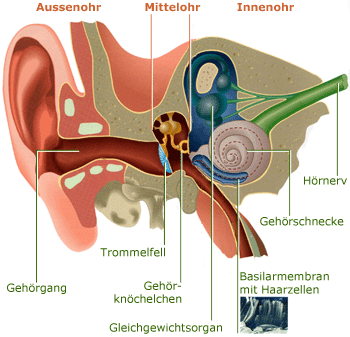
Das Außenohr umfasst den Ohrknorpel, die Ohrmuschel, das Ohrläppchen und den äußeren Gehörgang. Es dient zur Schallaufnahme und ist durch seine Wölbungen so geformt, dass der Schall von vorne besser aufgenommen und gebündelt wird. Somit ist die Ohrmuschel eine Art Verstärker mit natürlichem Richtmikrofon. Im Gehörgang erfolgt die Schallweiterleitung zum Trommelfell.
Der Schalltransport erfolgt durch das Mittelohr, wobei die Pars Tensa des Trommelfells nahezu die gesamte Schwingungsenergie aufnimmt. Die Gehörknöchelchenkette (Hammer, Amboss und Steigbügel) bewirken eine Hebelwirkung und die Flächentransformation vom Trommelfell zum ovalen Fenster. Die Binnenohrmuskeln bewirken eine Schutzfunktion vor lauten Pegeln und tieffrequenten Eigengeräuschen. Die Eustachische Röhre sorgt für den Druckausgleich.
Die Reizweiterleitung erfolgt durch das Innenohr - die Gehörschnecke. Die Vibration der Steigbügelfußplatte am ovalen Fenster bewirkt, dass die in der Cochlea befindliche Flüssigkeit in Schwingungen versetzt wird. Es wird eine Wanderwelle in Kraft gesetzt, die durch die Schnecke (Cochlea) läuft. Diese leitet die Schwingungen an die Haarsinneszellen, wo sie dann in elektrische Impulse umgewandelt werden. Diese Impulse werden anschließend über den Hörnerv an das Gehirn weitergeleitet. Dort hören und verstehen wir.
 0203 - 80 500 16
0203 - 80 500 16 





